
Boden sichern
Die Immobilie bildet das Fundament eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojekts. Viele Städte, Kommunen, Länder, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen, städtische Gesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, aber auch Privatpersonen besitzen Immobilien. Sie alle können zu mehr Gemeinwohl im Stadtteil beitragen, indem sie ihre Immobilien in eine gemeinwohlorientierte Nutzung übergeben und darum soll es hier gehen - mit welchen Methoden Grund und Boden für Jahrzehnte für eine gemeinwohlorientierte Nutzung gesichert werden kann.
In unseren Projekten versuchen wir, so früh wie möglich Nutzungsrechte an Grundstück und Gebäude zu sichern – und das für einen langen Nutzungszeitraum. Das ist die langfristige und stabile Basis unserer Projekte und damit wollen wir auch vermeiden, dass viele Ressourcen in eine Immobilienentwicklung ohne Fortführungsoption fließen und Erwartungen enttäuscht werden.
Wichtig ist: Die Nutzungsmöglichkeit von Grundstück und Gebäude sollte für die nächsten Jahrzehnte vertraglich gesichert sein. Für uns haben sich die Übernahme des Grundstücks im Erbbaurecht und der Kauf der darauf befindlichen Gebäude mehr als bewährt. Möglich ist dieses Modell unabhängig davon, ob die Grundstücke im Eigentum von Kommunen, von Wohnungsgesellschaften oder zum Beispiel privaten Eigentümer*innen- oder Erb*innengemeinschaften liegen. Diese Kombination sorgt dafür, dass die Immobilie langfristig für gemeinnützige Zwecke genutzt werden kann.
Nicht vergessen
Zustand der Immobilie genau prüfen
Der Kauf einer Immobilie ist ein großer Schritt – und ein spannender dazu! Dabei gibt es einiges zu beachten. Und eine gründliche Prüfung ist unerlässlich: Der tatsächliche Zustand der Immobilie ist etwa durch Grundbuchauszüge, Baulasten, Altlasten und bestehende Verträge zu überprüfen. Auch rechtliche und steuerliche Fragen sollten geklärt werden – und natürlich die Finanzierung. Der letzte Schritt ist die notarielle Beurkundung.
- Mehr Informationen dazu, was in einer Machbarkeitsstudie enthalten sein sollte, findet ihr in dieser Checkliste
Grundlagen für eine Immobiliennutzung schaffen
Letter of Intent oder Absichtserklärung
Das Instrument Letter of Intent (LOI) nutzen wir, um die Absicht zu erklären, zukünftig nach bestimmten Grundlagen mit weiteren Vertragsparteien zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit einer Stadt. Ein Letter of Intent wird häufig in der Anfangsphase von Vertragsverhandlungen verwendet. Der LOI kann beispielsweise den beabsichtigten Kauf einer Immobilie und ihre Nutzung zu bestimmten (zum Beispiel gemeinwohlorientierten) Zwecken betreffen. Die Rahmenbedingungen der weiteren Verhandlungen werden festgelegt. Zum Beispiel können ein Zeitrahmen für die weitere Prüfung, die Offenlage von vorliegenden Unterlagen - und die Anhandgabe der Immobilie für einen bestimmten Zeitraum vereinbart werden. Ein gut ausgearbeiteter LOI hilft, Missverständnisse in den Verhandlungen zu vermeiden, und bildet eine solide Grundlage für die gemeinsame Ausarbeitung eines verbindlichen Vertrags.
Anhandgabe
Im Rahmen eines LOI oder einer Absichtserklärung bietet das Modell der Anhandgabe eine gute Chance, schon früh das Grundstück nutzen und untersuchen zu können! Dabei wird es für einen bestimmten Zeitraum von den Grundstückseigentümer*innen zur Verfügung gestellt, um es in einer Zwischennutzung zu erkunden und zu beleben. Üblich sind ein bis zwei Jahre, je nach Komplexität der Untersuchungen und Entwicklungsprozesse. Der Zeitraum kann verlängert werden. Während des vertraglich festgelegten Zeitraums der Anhandgabe verhandelt der*die Grundstückseigentümer*in mit keiner anderen Partei – diese Exklusivität bietet einige Vorteile. Daher wird die Anhandgabe teilweise auch als Erstzugriffsrecht bezeichnet.
Die Anhandgabe gewährt Sicherheit für umfangreiche, kostenintensive technische Gebäudeprüfungen im Rahmen der Machbarkeitsstudie. Außerdem kann die Nutzungszusage und damit das Vertrauen der Grundstückseigentümer*innen ein überzeugendes Argument für eine Finanzierungszusage durch Geldgeber*innen und Finanzinstitute sein. Zugleich können während der Anhandgabe Nachbar*innen und Interessierte direkt auf das Gelände eingeladen werden, um gemeinsam Visionen zu entwickeln oder erste Nutzungsmöglichkeiten zu testen und zu erproben. Das hilft bei der Aufstellung und Testung eines langfristigen Nutzungskonzepts. Anhandgaben sind aus diesen Gründen auch sinnvoll im Rahmen von gemeinwohlorientierten Konzeptverfahren.
Download
Muster Absichtserklärung Anhandgabe
Ladet euch ein Muster einer Absichtserklärung inklusive Passus zur Anhandgabe in § 2 Abs. 2 herunter: “Im Rahmen von Voruntersuchungen entsprechend dieser Vereinbarung ist eine unentgeltliche Zwischennutzung des genannten Objektes durch die potenziell Erbbauberechtigte oder zwecks Aktionen für die Quartiersbewohnenden möglich.”
Erbbaurechts- und Kaufvertrag abschließen
Gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte setzen auf eine nachhaltige, soziale und zukunftsorientierte Stadtentwicklung – und das Erbbaurecht ist ein Schlüsselelement dafür. Mit einem Erbbaurechts- und Kaufvertrag können langfristige Ziele verfolgt werden: Das Eigentum an den Gebäuden geht auf gemeinnützige Organisationen oder Projektgesellschaften über (per Kaufvertrag), während das Grundstück in den Händen von Kommunen, Erb*innen-Gemeinschaften oder Wohnungsgesellschaften bleibt (per Erbbaurechtsvertrag). Beides wird in einem Vertrag gemeinsam geregelt. Der Vertrag sichert diese Konstellation für einen langen Zeitraum, in unseren Projekten zwischen 60 und 99 Jahre – eine echte Win-win-Situation.
Grundstück im Erbbaurecht übernehmen
- Das Erbbaurecht bietet eine gute Alternative zum klassischen Kauf. Das Grundstück wird nicht direkt gekauft, sondern für einen festgelegten Zeitraum gepachtet und genutzt. Dafür wird ein regelmäßiger Erbbauzins an die Eigentümer*innen gezahlt, die das Grundstück behalten. Das schafft eine starke, langfristige Partnerschaft, die allen Beteiligten Stabilität und Perspektiven bietet.
Aufstehende Gebäude kaufen
- In demselben Vertrag – dem Erbbaurechts- und Kaufvertrag – wechseln die auf dem Grundstück stehenden Gebäude den Besitz.
- Der*die Erbbaurechtsnehmer*in kann diese nun umbauen, aber auch den Gebäudebestand durch An-, Neu- oder Rückbau verändern – alles in Einklang mit dem geltenden Bau- und Planungsrecht.
Laufzeit
- Erbbaurechte sind langfristig angelegt – oft für 99 Jahre. Bei kürzeren Laufzeiten kann im Vertrag die Option für eine Verlängerung vereinbart werden, die dann in Kraft tritt, wenn der*die Erbbaurechtsnehmer*in zu einer im Vertrag festgelegten Frist eine Verlängerung anfragt.
- Der Name „Erbbaurecht“ kommt daher, dass es sogar innerhalb von Familien vererbt werden kann.
- Zudem wird vertraglich festgelegt, was passiert, falls die erbbaurechtsnehmende Organisation insolvent wird oder ihre Gemeinnützigkeit verliert – so bleibt alles klar geregelt.
Vorkaufsrechte
- Ein Bestandteil des Erbbaurechts- und Kaufvertrages ist meistens ein Vorkaufsrecht. Das bedeutet, wenn die Grundstückseigentümer*innen das Grundstück doch verkaufen wollen, wird es den Erbbaurechtsnehmer*innen als Erstes angeboten, bevor andere Vertragsparteien in Erwägung gezogen werden.
- Dies gibt den Erbbaurechtsnehmer*innen Sicherheit – insbesondere, sofern sie große Investitionen wie einen Um- oder Neubau tätigen.
Weitere Regelungen
- Im Erbbaurechtsvertrag können viele wichtige Punkte festgelegt werden, wie der Um- oder Neubau von Gebäuden auf dem Grundstück. Er regelt auch, wann das Erbbaurecht erlischt und das Grundstück an die Eigentümer*innen zurückfällt – das nennt sich Heimfall. Wenn der*die Erbbaurechtsnehmer*in zu diesem Zeitpunkt bereits investiert hat, kann vereinbart werden, dass diese Investitionen zum Verkehrswert erstattet werden.
- Auch die Möglichkeit, das Grundstück zu beleihen, kann geregelt oder ausgeschlossen werden. Änderungen am Vertrag müssen immer von beiden Parteien unterzeichnet und notariell beglaubigt werden.
Kosten
- Die Errichtung und Veräußerung von Erbbaurechten unterliegen der Grunderwerbsteuer. Zusätzlich fallen Kosten für die anwaltliche Beratung zu Ausgestaltung und Aufsetzen des Vertrages an und für den*die Notar*in im Rahmen des Vertragsabschlusses.
- Der Erbbauzins wird in der Regel auf Basis des Bodenwertes berechnet.
- Eine Klausel im Vertrag regelt die regelmäßige Anpassung, oft an den Verbrauchspreisindex (VPI).
- Wenn beide Parteien zustimmen, kann auch ein Verzicht auf die Erhebung des Erbbauzinses vereinbart werden (siehe unten).
Verzicht auf Erhebung des Erbbauzinses
- Nach dem Initialkapital-Prinzip verzichten Erbbaurechtsgeber*innen auf den Erbbauzins, solange das Projekt gemeinnützig bleibt. Dadurch können alle Überschüsse aus der Vermietung direkt als Gemeinwohlrendite in den Betrieb von Gemeinwohlflächen oder Nachbarschaftsangeboten fließen.
- Im Erbbaurechtsvertrag wird zwar ein Erbbauzins festgelegt, aber mit einer Klausel ausgesetzt: Solange die gemeinnützigen Ziele verfolgt werden und ein Quartiersbezug besteht, entfällt die Zahlung des Zinses. Damit leisten die Erbbaurechtsgeber*innen – neben der Bereitstellung ihres Grundstücks – einen finanziellen Beitrag zu mehr Gemeinwohl im Stadtteil.
- Da ein Erbbaurechtsvertrag komplex ist, solltet ihr immer rechtlichen Rat einholen. Diese Plattform bietet keine Rechtsberatung.
EU-Vergaberecht
- Kommunen müssen bei der Vergabe öffentlicher Flächen fair vorgehen und alle Bewerber*innen gleich behandeln – hier greift das Vergaberecht bzw. das Beihilfeverbot gemäß Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).
- Wenn jedoch im Erbbaurechtsvertrag festgelegt ist, dass und warum das Projekt nach EU-Recht als Unternehmen mit „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ (DAWI) gilt, kann eine Ausnahme von diesen Wettbewerbsregeln gemacht werden. Das kann zum Beispiel bei einem hohen Quartiersbezug und in der Gemeinnützigkeit der Fall sein.
- Diese Möglichkeit sollte in jedem Fall individuell geprüft und rechtlich abgesichert werden.
Download
Muster Erbbaurechts- und Kaufvertrag
- Ladet einen Muster Erbbaurechts- und Kaufvertrag herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.
- Für die Erstellung und Prüfung des Vertrags ist dringend anwaltliche Unterstützung und rechtliche Beratung erforderlich!
Im Stadtrat beschließen
Einige Entscheidungen auf dem Weg zu einem gemeinwohlorientierten Immobilienprojekt benötigen eine formale Zustimmung der Stadt, das heißt der städtischen Abgeordneten (manchmal auch Ratsmitglieder, Mitglieder des Rates oder Stadtverordnete genannt), die durch einen Beschluss erfolgt. Grundlage dafür ist eine sogenannte Beschlussvorlage – ein offizielles Dokument, das alle relevanten Informationen und Details des Projekts bündelt. Diese Vorlage wird von den städtischen Gremien geprüft und dient dem Stadtrat als Entscheidungsbasis. Sobald der Stadtrat die Beschlussvorlage mehrheitlich annimmt, ist die Rolle der Kommune klar definiert. Die Beschlussvorlage kann dabei Grundsatzentscheidungen oder Vertragsfragen, wie etwa Erbbaurechtsverträge, regeln.
Was wird in einer Beschlussvorlage beschlossen?
- Die Stadt spielt eine wichtige Rolle bei gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten, besonders wenn es um Grundstücksgeschäfte wie Kauf, Verkauf oder Schenkungen von öffentlichen Grundstücken geht – das muss in der Regel vom Stadtrat demokratisch beschlossen werden. Auch Erbbaurechtsverträge und finanzielle Entscheidungen, bei denen die Stadt mit eigenen Mitteln beteiligt ist, brauchen eine Zustimmung des Stadtrats.
- Das gilt auch bei größeren Förderungen, wenn die Stadt einen Eigenanteil beisteuern muss,
- und im Planungsprozess, wenn zum Beispiel ein Bebauungsplan überarbeitet oder neu erstellt werden muss.
- Einige Entscheidungen können jedoch auch ohne Stadtratsbeschluss getroffen werden, wie das Unterzeichnen eines Letter of Intent (LOI) oder von Nutzungsgestattungsverträgen durch die zuständigen Dezernate.
Wie kommt eine Beschlussvorlage in den Rat?
- Die Stadtverwaltung erstellt die Beschlussvorlage und stimmt sie intern zwischen den verschiedenen Dezernaten ab. Die zuständigen Fachabteilungen bringen die Vorlage zuerst in die Fachausschüsse und von dort geht sie weiter in den Stadtrat. Dieser ganze Prozess kann einige Wochen bis Monate dauern.
Warum ist eine Beschlussvorlage wichtig?
- Besteht ein formaler Beschluss, so ist die Unterstützung der Stadt für das gemeinwohlorientierte Immobilienprojekt rechtlich verbindlich zugesichert. Außerdem haben wir gelernt, dass mit den politischen Fraktionen wichtige Akteur*innen über das gemeinwohlorientierte Immobilienprojekt informiert sind und es unterstützen.
Wichtige Inhalte der Beschlussvorlage zum Erbbaurechts- und Kaufvertrag
- Der Erbbaurechts- und Kaufvertrag regelt die Nutzung des Grundstücks.
- Ist ein Verzicht auf Erbbauzins beschlossen, verzichtet die Stadt für die Dauer der gemeinnützigen Nutzung auf den jährlichen Erbbauzins.
- Die Vorlage beschreibt unter dem Punkt finanzielle Auswirkungen die finanziellen Folgen aus Sicht der Stadt. Das sind zum Beispiel entgangene Einnahmen, aber können auch Gutachten zum Wert des Grundstücks und Gebäudes sein.
Eine Immobilie verschenken
Manchmal werden Immobilien tatsächlich verschenkt! Eine Schenkungsurkunde regelt dabei die unentgeltliche Übertragung von Grundstücken an Einzelpersonen oder Organisationen wie Vereine oder Stiftungen. Wir haben gelernt: Auch im Rahmen einer Schenkung gilt, die Immobilie so genau wie möglich zu beschreiben, die Pflichten der Schenkenden und der Beschenkten zu nennen und die Haftung für mögliche Mängel auszuschließen. Auch das Widerrufsrecht der Schenkenden sowie die Übernahme von Kosten und Steuern werden festgelegt. In der Schenkungsurkunde kann zudem bestimmt werden, dass die Immobilie zurückübertragen wird, wenn die Gemeinnützigkeit entfällt oder die Betriebskosten nicht mehr tragbar sind. Ist alles geklärt, wird die Schenkungsurkunde notariell beglaubigt und ins Grundbuch eingetragen.
Schenkungen sollten jedoch gut überlegt sein, denn auch geschenkte Immobilien verursachen Kosten. Zunächst sind Gebühren für den Termin bei dem*der Notar*in und die Schenkungssteuer zu beachten – bei Grundstücken und Gebäuden können große Sachwerte bestehen. Außerdem müssen die Beschenkten als die neuen Besitzer*innen für Grundsteuer, Entsorgung, Versicherungen und weitere Betriebskosten aufkommen. Eine Alternative zur Schenkung kann die Sachspende sein – um dies zu prüfen, ist eine gute Steuerberatung gefragt.
Download
Muster Schenkungsurkunde
Ladet eine Muster Schenkungsurkunde herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt.
Gemeinwohlorientierte Konzeptverfahren
Konzeptverfahren sind ein Instrument zur Veräußerung von Immobilien. Nicht das höchste Gebot, sondern das überzeugendste Konzept entscheidet darüber, wer die Immobilie bauen und nutzen darf. Damit sind sie ein gutes Instrument, um mehr gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte zu ermöglichen. Indem sie das Konzept und nicht den Preis in den Vordergrund stellen, sorgen sie auch für mehr Chancengerechtigkeit in der Verteilung von Boden und Immobilien.
Zurzeit erarbeitet die Montag Stiftung Urbane Räume mit einem 18-köpfigen Beirat Kriterien und Verfahrensschritte für gemeinwohlorientierte Konzeptverfahren.
Per Nutzungsvertrag Flächen nutzen
Die Nutzung öffentlicher oder privater Flächen – etwa für Zufahrtswege, Feste, Parkplätze oder Infrastrukturmaßnahmen – erfordert klare rechtliche Vereinbarungen und Genehmigungen.
Bei einer kurzzeitigen Nutzung, wie zum Beispiel einer Straßensperrung für ein Fest, müssen Genehmigungen eingeholt werden. Da Straßenflächen meist im Besitz von Kommunen oder staatlichen Institutionen sind, werden hier Genehmigungen für die einmalige Nutzung eingeholt. Für langfristige Nutzungen kommt der Nutzungsgestattungsvertrag in Betracht.
Ein Nutzungsgestattungsvertrag legt fest, wer öffentliche oder private Flächen wie Grundstücke oder Wege zu welchen Bedingungen dauerhaft nutzen darf. Dabei geht es nicht nur um die Erlaubnis zur Nutzung, sondern auch um Pflichten: Wer sorgt für die Pflege von Pflanzen, beseitigt Laub und trägt die entstehenden Kosten? Auch Haftungsfragen sind im Vertrag genau geregelt, sodass klar ist, wer für eventuelle Schäden verantwortlich ist. So sorgt ein Nutzungsgestattungsvertrag für Sicherheit und Klarheit – und ermöglicht es, öffentliche und private Flächen sinnvoll und langfristig zu nutzen.
Download
Muster Nutzungsgestattungsvertrag
Ladet einen Muster Nutzungsgestattungsvertrag herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.
Wichtige Unterlagen für den Um- und Neubau
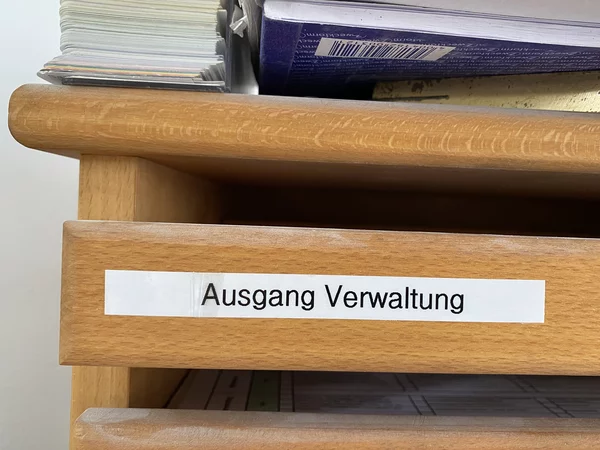
Neu- und Umbau beantragen
Fast alle Um- und Neubauten sind genehmigungspflichtig. Das heißt, vor Baubeginn muss ein Antrag bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden. Der Bauantrag muss von Bauherr*innen und Architekt*innen unterschrieben sein. Zum Bauantrag sind verschiedene Unterlagen einzureichen:
- Lageplan,
- Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten),
- Baubeschreibung,
- Berechnung und Angaben zur Kostenermittlung,
- Erhebungsbogen für die Baustatistik und
- Angaben zum Artenschutz.
- Weitere Unterlagen können ebenfalls gefordert werden wie eine Berechnung von Abstandsflächen und Stellplatznachweise auf dem eigenen Grundstück.
- Eine erste Übersicht, was in der Machbarkeitsstudie alles relevant ist, kann auf dieser Plattform als Checkliste abgerufen werden.
Es ist daher ratsam, in engem Austausch mit der kommunalen Bauaufsicht und dem Architekturbüro zu stehen! Eine Genehmigung kann bei komplexen Vorhaben und je nach personellen Kapazitäten in den Kommunen mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern. Diese Zeit sollte bei Bauvorhaben eingeplant werden.
Grundstücke neu ordnen
Zur Umsetzung mancher Baumaßnahmen kann es sinnvoll oder sogar unerlässlich sein, Grundstücksgrenzen neu zu ziehen. Gründe dafür können sein, dass alte Grundstücksgrenzen nicht mehr zum aktuellen oder geplanten Bestand passen oder dass manche Grundstücke entsprechend Förderauflagen nicht beliehen werden sollten.
Vor einer Neuordnung muss die Fläche von einem*einer Vermessungsingenieur*in vermessen werden. Der*die Vermessungsingenieur*in wird öffentlich bestellt und erstellt einen amtlichen Lageplan. Die Grundstücksneuordnung (Teilung oder Zusammenlegen beziehungsweise Verschmelzung) muss zunächst von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden, dann kann sie durch eine*n Notar*in erfolgen. Das Katasteramt trägt die Änderungen im Liegenschaftskataster ein, das Grundbuchamt trägt sie in das Grundbuch ein. Diese Vorgänge brauchen einige Wochen bis Monate und können durchaus mehrere Tausend Euro kosten. Während die Verwaltungsgebühren von den Bundesländern festgelegt werden, hängen die Kosten der Leistungen der Vermessungsingenieur*innen von ihren Aufwänden ab. Die Wartezeiten sind zu bedenken, sofern die Grundbucheintragung für eine anschließende Baugenehmigung benötigt wird.

Immobilie und Grundstück versichern
Beim Immobilienkauf hat sich für uns gezeigt, wie wichtig Versicherungen sind, um sich gegen unvorhersehbare Risiken abzusichern. Eine frühzeitige Absicherung vor Schäden, rechtlichen Streitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen bietet Sicherheit und sorgt dafür, dass die Projektziele langfristig verfolgt werden können. Einige Versicherungen sind beim Immobilienkauf nützlich.
- Gebäudeversicherung: deckt Schäden am Gebäude durch Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser und Elementarschäden ab. Neben Anschrift und Angaben zum Erbbaurechtsvertrag oder der Grundbucheintragung sind zur Meldung die Mietfläche und bereits vermietete Fläche sowie der*die Voreigentümer*in anzugeben.
- Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitzende: schützt Eigentümer*innen vor Schadensersatzansprüchen, zum Beispiel wenn jemand auf dem Grundstück zu Schaden kommt. Diese Versicherung gibt es auch speziell für leerstehende Gebäude und ehemalige Betriebsgrundstücke. Der Antrag muss auf den Zustand der Gebäude, Altlasten, Vornutzung, Größe des Grundstücks und Vorschäden der letzten drei Jahre eingehen.
- Rechtsschutzversicherung: schützt vor den Kosten eines Rechtsstreits, etwa bei Vertragsstreitigkeiten im Rahmen des Immobilienkaufs oder der Erbringung von Architektur- und Bauleistungen.
Aus Kostengründen ist immer abzuwägen, welche der Versicherungen sinnvoll sind. Zu anderen Zeitpunkten der Projektentwicklung – vor allem während ihr baut – ist es sinnvoll, weitere Versicherungen abzuschließen.
Baulasten und Dienstbarkeiten ermitteln
Grundstücke können mit rechtlichen Verpflichtungen wie Baulasten oder Dienstbarkeiten belegt sein. Vor dem Kauf und der Übernahme von Grundstücken im Erbbaurecht ist es unserer Erfahrung nach sehr wichtig, dass alle Verpflichtungen bekannt sind. Denn mit ihnen können Kosten einhergehen, die in die Mehrjahresplanung einfließen sollten. Eine gründliche Prüfung von Baulasten und Dienstbarkeiten ist wichtig, um sicherzustellen, dass sie mit den Projektzielen im Einklang stehen und keine unerwarteten Hindernisse schaffen. So lassen sich spätere Konflikte vermeiden und das Projekt kann reibungslos umgesetzt werden – im Einklang mit den lokalen Vorgaben und der Gemeinschaft.
Baulasten
Baulasten entstehen, wenn Bauvorhaben nicht vollständig auf dem eigenen Grundstück umgesetzt werden können. In diesem Fall dürfen benachbarte Grundstücke zum Beispiel als Abstandsflächen genutzt werden. Alle Baulasten werden im Baulastenverzeichnis festgehalten und bleiben bestehen, selbst wenn das Nachbargrundstück den*die Besitzer*in wechselt. Bevor also ein neues Bauprojekt startet, sollte geprüft werden, ob das Grundstück durch eine Baulast belastet ist. Eine Baulast kann bei der Bauaufsichtsbehörde eingetragen oder bei Bedarf gelöscht werden.
Vom Namen her ähnlich, aber ein ganz anderes - und ähnlich komplexes - Thema sind Altlasten.
Dienstbarkeiten
Das sind zum Beispiel Wegerechte oder Leitungsrechte. Sie erlauben Dritten die Nutzung eines Teils des Grundstücks, etwa für das Verlegen von Versorgungsleitungen oder das Errichten von Infrastruktur. Diese Rechte sind im Grundbuch eingetragen und bleiben auch bei einem Verkauf des Grundstücks bestehen. Vor einem Um- oder Neubau sollte deshalb immer geprüft werden, welche Dienstbarkeiten bestehen und ob diese geändert werden müssen.
Ein Beispiel: Wenn eine alte Fabrik in ein soziales Wohnprojekt umgewandelt werden soll und eine Dienstbarkeit für einen Stromtrafo besteht, muss diese in die Planung integriert oder geändert werden, um das Projekt reibungslos umsetzen zu können.


