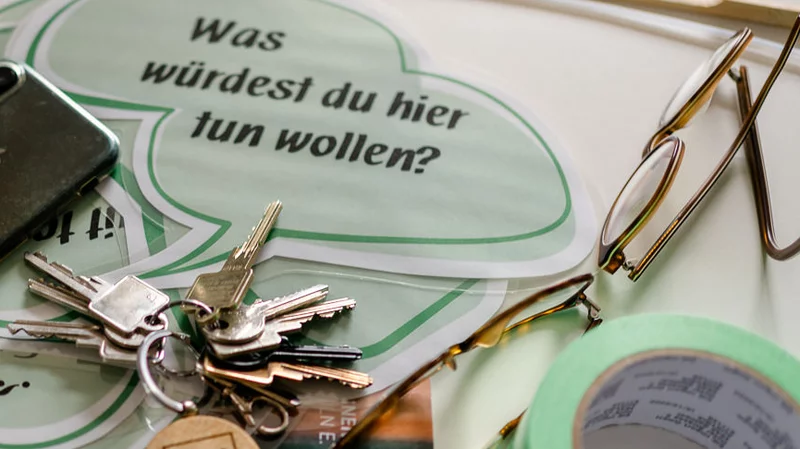Strukturen schaffen
Eine Immobilie ist gefunden, Ideen und Visionen sind gemeinsam erarbeitet und die Finanzierung ist darstellbar. Nun geht es darum, verbindliche Zusagen zu geben, vertragliche Grundlagen zu legen, die Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen möglichst früh auf sichere Beine zu stellen.
Wir nutzen die Rechtsform der gemeinnützigen Gesellschaft (gGmbH). Das kleine Team der gGmbH bezieht ein Projektbüro vor Ort und koordiniert alle anstehenden Aufgaben. Außerdem ist es nach unserer Erfahrung wichtig, dass früh verbindliche Zusagen zu Kooperationen vereinbart und festgehalten werden, um das gemeinwohlorientierte Immobilienprojekt ins Rollen zu bringen. Zum Beispiel werden hier die Beiträge der Projektbeteiligten festgehalten - wer bringt welche Geldsummen ein, verpflichtet sich zur Gemeinnützigkeit oder ermöglicht einen reibungslosen Bauablauf.
Gemeinsame Ziele werden festgelegt und es besteht eine gute Grundlage, um die Grundstücke und Gebäude zu erwerben bzw. zu pachten.
Wer zu mehr Gemeinwohl im Stadtteil beiträgt
Bei der gemeinwohlorientierten Stadtteilentwicklung arbeiten verschiedene Partner*innen eng zusammen, um ein nachhaltiges, inklusives und sozial gerechtes Quartier zu gestalten. Die wichtigsten Akteur*innen und ihre Rollen aus unserer Perspektive sind:
Grundstückseigentümer*innen und -erb*innen
- Grundstückseigentümer*innen und -erb*innen spielen eine zentrale Rolle, indem sie ihre Grundstücke über Jahrzehnte für gemeinwohlorientierte Nutzungen zur Verfügung stellen.
- Nach unserem Initialkapital-Prinzip verzichten sie dabei auf die Erhebung der Erbbauzinsen, solange das Projekt gemeinnützig bleibt. Indirekt stellen sie damit die ihnen entgangenen Einnahmen als Gemeinwohlrendite dem Stadtteil zur Verfügung.
- Auf dem Grundstück aufstehende Gebäude geben sie in den Besitz der Projektgesellschaft und verzichten damit auf eine private Weiternutzung.
Geber*innen und Gemeinwohl-Investor*innen
- Geber*innen und Gemeinwohl-Investor*innen bringen Kapital ein und stellen bei gemeinwohlorientierten Immobilienprojekten Gelder für Sanierung oder Neubau der Immobilie als Eigenmittel zur Verfügung.
- Diese Eigenmittel beziehungsweise das Eigenkapital ermöglicht weitere Finanzierungszusagen und muss nach dem Initialkapital-Prinzip nicht zurückgezahlt werden.
Stadtverwaltung (Fachämter und Dezernate)
- Häufig sind mehrere Ämter und Behörden der Stadtverwaltung in ein gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt eingebunden, zum Beispiel Planungsamt, Grünflächenamt, Kämmerei, Sozialamt.
- Die Stadtverwaltung unterstützt das Projekt mit Planungsrecht, Genehmigungen und Bereitstellung von Infrastrukturen.
- Sie kann selbst Grundstücke zur Verfügung stellen und stellt bei der Beantragung von Städtebaufördermitteln Eigenanteile bereit.
- Durch diese Vielschichtigkeit ist die Kooperation mit der Stadt eine zentrale Grundlage des Projektes und in Kooperationsvereinbarungen schriftlich festzuhalten.
- Da gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte mehrere Zuständigkeiten berühren, ist es unserer Erfahrung nach sinnvoll, wenn sie auf einer möglichst hohen Ebene der Stadtverwaltung, zum Beispiel auf Dezernatsebene, Unterstützung erfahren und eine feste Ansprechperson aufseiten der Stadtverwaltung benannt wird.
- Auch die Einrichtung eines Lenkungskreises kann zu einer besseren Absprache beitragen.
- Meist gibt es verwaltungsinterne Strukturen und Termine, in denen mehrere Ämter zusammenarbeiten. Diese Treffen können unterschiedlich benannt sein, zum Beispiel “Verwaltungskonferenz” oder “Bauaktenkonferenz”. Auch hier kann eine Platzierung des Projektes sinnvoll sein.
Gemeinnützige Projektgesellschaft als Bauherrin vor Ort
- Eine gemeinnützige Gesellschaft – bei uns in der Rechtsform der gGmbH – verantwortet als Bauherrin die Immobilien sowie die partizipative Entwicklung.
- Außerdem baut sie Strukturen für die Hausverwaltung auf, stellt den laufenden Betrieb sicher und gewährleistet, dass die gemeinnützigen Ziele dauerhaft verfolgt werden.
- Kurz: Das Team der gGmbH übernimmt vielfältige Aufgaben.
Mieter*innen des gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes
- Mieter*innen wohnen oder arbeiten in der Projektimmobilie. Damit haben sie eine spezifische Orts- und Alltagskenntnis des Projektes.
- Mieten sie in dem Projekt selbst, tragen sie mit den Mieten, die sie aufbringen, zur Gemeinwohlrendite bei.
- Auch sie profitieren von den Gemeinwohlflächen und Angeboten, übernehmen Aufgaben wie die Grünpflege oder leiten nachbarschaftliche Angebote wie Sportkurse oder ein Nähcafé.
Menschen im Stadtteil
- Die Möglichkeiten, am Projekt teilzuhaben, sind sehr vielfältig.
- Die Bewohner*innen des Stadtteils bringen ihre Perspektiven und Erfahrungen in den Planungsprozess ein, nutzen und gestalten die Immobilie mit, sind Projektbotschafter*innen, leiten Angebote, beteiligen sich in Gremien und beim Betrieb oder übernehmen eine Beetpatenschaft im Garten. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt.
Formale und non-formale Bildungseinrichtungen
- Bildungseinrichtungen - ob formale (zum Beispiel Schulen) oder non-formale (zum Beispiel Stadtteilbibliotheken) - sind zentrale Anlaufstellen im Stadtteil.
- Lehrkräfte, Schulleitungen und Schüler*innen, aber auch andere Bildungsträger wie die Betreiber*innen lokaler Kindergärten, eines offenen Ganztags beziehungsweise der Nachmittagsbetreuung und von Stadtteilbüchereien kennen sich gut im Stadtteil aus und verfügen über viele Angebote und Räume. Mit ihnen zusammenzuarbeiten kann sehr gute Beiträge für mehr Gemeinwohl bedeuten.
- Bei der Entwicklung von Schulen und der Vernetzung von Bildungseinrichtungen bestehen häufig Schnittstellen zu gemeinwohlorientierten Immobilien.
Lokale Organisationen, Vereine und Akteur*innen
- Manche Menschen sind im Stadtteil besonders aktiv oder bereits in Gruppen und Vereinen organisiert oder haben bei sozialen Träger*innen oder Bildungseinrichtungen einen bestimmten Auftrag.
- Sie haben wichtiges Fachwissen in sozialen und kulturellen Themen, sind vor Ort vernetzt und leisten wichtige Arbeit.
- Sie können die Bedarfe im Stadtteil einschätzen und in Kooperationen ihre Schwerpunkte einbringen.
- Als Multiplikator*innen haben sie Zugang zu einigen Communities.
Lokalpolitik
- Vertreter*innen in Bezirks- oder Ortsvertretungen sind häufig lokal engagiert und vernetzt.
- In ihren regelmäßigen Sitzungen kann das Vorhaben vorgestellt und Feedback eingeholt werden. Diskussionen in parlamentarischen Gremien tragen auch zur Sichtbarkeit des Projektes bei.
- Sofern Grundstücke in kommunalem Eigentum Teil des Immobilienprojektes sind, ein neuer Bebauungsplan notwendig ist oder öffentliche Fördergelder beantragt werden, müssen der Stadtrat und je nach Bundesland die Bezirksvertretung beziehungsweise der Ortsbeirat als parlamentarische Gremien mehrheitlich der Beschlussvorlage zustimmen.
- Vor den Entscheidungen sollten den Fraktionen und Abgeordneten die Projektgrundlagen und -ziele als Entscheidungsgrundlage vorgestellt werden.
Fachexpert*innen
- Handwerksunternehmen, Architekturbüros, Landschaftsarchitekt*innen, Stadtentwicklungsbüros und Fachplaner*innen bringen ihr Wissen ein, um die Immobilie zu einem Ort zu machen, der langfristig besteht und den Nutzer*innen Wertschätzung entgegenbringt.
Forschende und Lernende
- Mit aktuellen Ansätzen und Forschungsfragen sind Universitäten am Zahn der Zeit.
- In Praxis-Kooperationen bringen sie Ideen aus der ganzen Welt in die Projekte ein, wenden ihr gelerntes Wissen direkt an und tragen zur Bekanntheit guter Beispiele bei.
Eine gemeinnützige GmbH gründen
In unserem Initialkapital-Prinzip ist die Gemeinnützigkeit nicht zuletzt in der Rechtsform der operativen Projektgesellschaft festgeschrieben: Es wird eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) gegründet, um vor Ort aktiv zu sein und das Immobilienprojekt umzusetzen. Anders als bei einer klassischen GmbH steht bei einer gGmbH nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund, sondern sie verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Was offiziell als gemeinnützig gilt, ist in Deutschland in Paragraf 52 der Abgabenordnung (AO) festgehalten. Überschüsse müssen reinvestiert werden, um die gemeinnützigen Zwecke zu verfolgen.
Im Gesellschaftsvertrag sind die gemeinnützigen Zwecke festgeschrieben, die die Gesellschaft verfolgt. Außerdem werden die Gesellschafter*innen genannt und mindestens ein*e Geschäftsführer*in benannt. In unseren Projekten benennen wir zwei Personen in die Geschäftsführung, wobei eine operativ tätig ist und die zweite ausschließlich beratend. In einem unvorhergesehenen Notfall bleibt die Gesellschaft handlungsfähig, da eine zweite Person unterschriftsberechtigt ist.
Jedes Jahr wird im Tätigkeitsbericht genau beschrieben, wie die gemeinnützigen Zwecke aus dem Gesellschaftsvertrag verfolgt wurden. Dieser Nachweis muss für alle genannten Zwecke jährlich erbracht werden. Bereits bei der Gründung ist es unserer Erfahrung nach deshalb sinnvoll, diese Zwecke genau zu bestimmen und sich beim Finanzamt Beratung einzuholen.
Im Gründungsprozess bringen die Gesellschafter*innen – dies können neben Privatpersonen andere Organisationen oder Körperschaften sein – Stammkapital in Höhe von mindestens 25.000 Euro ein. Mindestens die Hälfte der Summe muss zu Beginn gezahlt werden. Die offizielle Gründung erfolgt durch eine*n Notar*in. Hierfür sind Notarkosten zu bedenken. Die Eintragung ins Handelsregister ist der letzte Schritt zur Gründung. Diese kann einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Dabei ist zu bedenken: In dieser Gründungszeit liegt die finanzielle Haftung bei der Vornahme von Rechtsgeschäften persönlich bei den eingetragenen Geschäftsführenden.
In den Projekten der Montag Stiftung Urbane Räume ist die Dachstiftung der Stiftungsgruppe, die Carl Richard Montag Förderstiftung, zu 100 Prozent Gesellschafterin der gemeinnützigen Projektgesellschaften.
Dieses Muster kombiniert Satzung und Gesellschaftsvertrag einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH). Es regelt gemeinnützige Zwecke, Vermögen, Geschäftsführung, Rechte der Gesellschafter*innen und die Verwendung von Gewinnen für ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Änderungen am Gesellschaftsvertrag bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter*innen.
Gemeinnützigkeit nach Paragraf 52 Abgabenordnung (AO)
Eine verbindliche Grundlage für unsere Projekte ist die Gemeinnützigkeit. Über die Rechtsform gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) stellen wir sicher, dass die Gesellschaft ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Eine solche gemeinnützige Rechtsform hat für uns ein klares Ziel: Sie setzt sich voll und ganz für das Gemeinwohl ein!
- In der Satzung müssen die gemeinnützigen Zwecke stehen und wie die Gesellschaft diese erfüllt.
- Welche Zwecke in Deutschland als gemeinnützig gelten, ist gesetzlich festgelegt (in Paragraf 52 der Abgabenordnung, kurz: AO). Ein gemeinwohlorientiertes Immobilienprojekt kann mehrere der im Gesetz definierten Zwecke verfolgen. Verantwortung hierfür trägt am Ende die Geschäftsführung. Alle Zwecke müssen im Gesellschaftsvertrag beziehungsweise der Satzung verankert sein. In jedem Jahr müssen Tätigkeiten erfolgen, die alle in der Satzung genannten Zwecke verfolgen. Es ist daher ratsam, nur die Zwecke in die Satzung zu übernehmen, die die Gesellschaft Jahr für Jahr erfüllt.
- Gegenüber dem Finanzamt muss die Erfüllung jedes Zweckes im jährlichen Tätigkeitsbericht nachgewiesen werden. Auch für die Erstellung des Tätigkeitsberichtes ist die Geschäftsführung verantwortlich.
- Die Satzung zu ändern, um einen Zweck zu streichen oder hinzuzufügen, erfordert die Eintragung durch eine*n Notar*in und sollte dringend vorab mit dem Finanzamt abgestimmt werden. Das kostet wiederum. Kurzum: Die Zwecke, die in die Satzung übernommen werden, sollten gut überlegt und realistisch erfüllbar sein.
- Die Satzung wird dem Finanzamt vorgelegt. Sofern die Gemeinnützigkeit aus Sicht des Finanzamtes als Prüfbehörde besteht, kann die gemeinnützige Gesellschaft von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit werden. Dann ist die Gesellschaft eine steuerbefreite Körperschaft. Wichtig ist, dass keine Gewinne an Gesellschafter*innen ausgeschüttet werden. Stattdessen verbleiben alle während der Gemeinnützigkeit erzielten Überschüsse als Gemeinwohlrendite im Stadtteil. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen auch an andere gemeinnützige Organisationen gegeben werden.
- Für die Finanzierung und den Betrieb eines gemeinwohlorientierten Immobilienprojektes ist die steuerrechtliche Sicht auf Einnahmen und Ausgaben wichtig. Sie werden unterschieden in die Sphären: ideelle Tätigkeiten, Vermögensverwaltung sowie gegebenenfalls wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und wirtschaftlicher Zweckbetrieb. Die ideellen Tätigkeiten erfüllen die gemeinnützigen Satzungszwecke. Die Vermögensverwaltung wiederum kann für langfristige Geldanlagen genutzt werden, die das Durchführen von ideellen Tätigkeiten ermöglichen.
- Wichtig für gemeinwohlorientierte Immobilienprojekte: Langfristige, regelmäßige Vermietung zählt als Vermögensverwaltung. Anders sieht es bei kurzfristiger Vermietung aus, zum Beispiel für einzelne Veranstaltungen. Dann liegt ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor und es gelten andere Vorschriften für die Buchhaltung.
- Mehr zu Vermögensverwaltung
- Mehr zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
- Mehr zu Raumüberlassung in der Gemeinnützigkeit
Download
Muster Gesellschaftsvertrag gemeinnützige GmbH
Ladet einen Muster Gesellschaftsvertrag für eine gemeinnützige GmbH herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.

Mit einem Team vor Ort
In unseren Projekten arbeiten Menschen mit verschiedenen (Berufs-)Erfahrungen im Team der gGmbH (auch Projektgesellschaft) zusammen. Ein Team besteht in der Regel aus Geschäftsführung, Office-Manager*in, Gemeinwohl-Manager*in, Hausverwaltung und Hausmeisterei. In der Planungs- und Bauzeit wird das Team gegebenenfalls durch eine technische Projektsteuerung ergänzt. Das Team der Projektgesellschaft ist als eigenständige Wirtschaftseinheit vor Ort tätig – es hält die Projektkosten im Blick und passt die Budgetplanungen laufend an.
Die Aufgaben reichen von der strategischen Planung über die Umsetzung gemeinnütziger Projekte bis hin zur Finanzverwaltung. Die Geschäftsführung trägt die Gesamtverantwortung und ist verpflichtet, im Sinne der Gemeinnützigkeit zu handeln.
Eine klare Rollenverteilung innerhalb der Organisation stellt sicher, dass die komplexe Aufgabenstellung, gemeinwohlorientiert eine Immobilie umzubauen und im Stadtteil zu verankern, gut erfüllt werden kann. Das hat sich in der Praxis bewährt. Jedes Teammitglied und jede Rolle ist für die erfolgreiche Umsetzung und den Betrieb einer gGmbH entscheidend.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Zusammensetzung des Teams, der Kompetenzen und der Zeitressourcen für einzelne Aufgaben über die Projektlaufzeit stetig ändert. Für manche Aufgabenbereiche reicht eine Teilzeitstelle, unter Umständen können mehrere Aufgabenfelder auch in einer (vollen) Personalstelle gebündelt werden.
Rollen in der gGmbH
Geschäftsführung
- Der*die Geschäftsführer*in trägt die Gesamtverantwortung für die Gesellschaft, übernimmt im Umbauprozess der Immobilie die Rolle der Bauherr*innenvertretung, ist für Budgetplanung, Vertragsmanagement und Personalentscheidungen verantwortlich.
Hausverwaltung/Vermietung
- Der*die Hausverwalter*in ist ansprechbar in allen Belangen der Hausverwaltung und Vermietung, bei der Erstellung und Verwaltung der Mietverträge, der Betriebskostenabrechnung, Rechnungsbearbeitung, Verwaltung der Objektstammdaten und des Schlüsselmanagements.
Gemeinwohl-Management
- Der*die Gemeinwohl-Manager*in organisiert Veranstaltungen und Beteiligungsformate und hält Kontakt in den Stadtteil.
- Das bedeutet im Detail Entwicklung und Umsetzung von Gemeinwohlprojekten, Community Building, Vernetzung mit lokalen Akteur*innen, Durchführung von Workshops und Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem Erstellung von Kommunikationsmaterialien, Pflege von Website und Social Media, Organisation von Pressekonferenzen.
Facility Management/Hausmeisterei
- Der*die Hausmeister*in übernimmt Tätigkeiten rund um das Gebäude und ermöglicht ein reibungsloses und gefahrloses Nutzen der Gebäude und Außenflächen, Betreuung und Instandhaltung der Immobilien, Betreuung von kleineren Reparaturarbeiten durch Handwerksunternehmen, Schließdienste.
Office-Management
- Der*die Office-Manager*in regelt anfallende Organisationsaufgaben, zum Beispiel Rechnungsbearbeitung, Posteingang, Lieferungsmanagement und Terminplanung.
Technisches Projektmanagement
- Der*die technische Projektmanager*in steuert Bauprozesse, das heißt Planung und Überwachung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen, Koordination von Planer*innen und Baufirmen, Baubetreuung, Qualitätskontrolle.
FSJ/BFD
- Möglicherweise könnt ihr das Team im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder eines Bundesfreiwilligendienstes ergänzen.
- Die Aufgaben sind vielfältig: handwerkliche Tätigkeiten, Gespräche mit Nachbar*innen, Bespielung von Social Media, Unterstützung von Projektpartner*innen, Aufgaben bei Veranstaltungen.
Kontakte im Stadtteil
Alle im Team arbeiten gemeinsam daran, die Ziele der Gesellschaft zu erfüllen und mehr Gemeinwohl im Stadtteil zu schaffen. Doch Rollen wie die Office-Management, Hausverwaltung und Hausmeisterei finden häufig – leider – weniger Beachtung. Dabei sind gerade die Personen mit diesen Stellen viel vor Ort und zentral für den Kontakt mit den Menschen im Stadtteil und den Mieter*innen im Gebäude.
Gemeinwohl managen
Mit dem Gemeinwohl-Management haben wir eine neue Rolle für die gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung etabliert: Hier geht es uns darum, kontinuierlich einen Draht in den Stadtteil aufzubauen und zu halten und eine inklusive Gemeinschaft zu stärken, das Engagement dieser Gemeinschaft zu koordinieren und gute Bedingungen für Empowerment und Selbstwirksamkeit zu schaffen.
Kontinuierlich bringen Gemeinwohl-Manager*innen Menschen wie Nachbar*innen, Mieter*innen, Nutzer*innen und Akteur*innen mit den Potenzialen der Immobilie zusammen. Dafür müssen sie sowohl Einblick in Bauabläufe und technische Fragen haben als auch verschiedene Lebensrealitäten im Blick behalten, kommunikativ sein, Veranstaltungen organisieren und mit anderen Akteur*innen zusammenarbeiten.
Die Rolle ändert sich mit der Zeit: von einem Ankommen und Kennenlernen des Stadtteils, der Bewohner*innen und Strukturen zum gemeinsamen Erproben der Räume und ihrer Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ein mehrtägiges Mitmachfestival mit Handwerksbetrieben und Kunstschaffenden die Stärken und die Vielfalt eines Stadtteils sichtbar machen. Schließlich geht es auch darum, Strukturen zu schaffen, damit die Menschen im Stadtteil selbstständig Aktivitäten organisieren können. Das kann von der Einladung zu einem monatlichen Plenum über die Ausarbeitung eines Nutzungsvertrages für Gemeinwohlflächen bis zur Beratung für die Gründung eines eigenen Vereins zum Betrieb dieser Flächen gehen.
Ein Projektbüro vor Ort einrichten
Für unsere Projekte ist das Projektbüro die zentrale Anlaufstelle: unverzichtbar in der Projektentwicklung und später auch im Betrieb. Wir haben festgestellt, dass die räumliche Nähe hilft, den direkten Kontakt zu Bewohner*innen und Akteur*innen im Quartier zu gewährleisten. Das Projektbüro ist Anlaufstelle für Fragen und Anliegen und fördert so das Vertrauen und die Teilhabe der Gemeinschaft am Projekt. Durch die Präsenz vor Ort können Entscheidungen schneller getroffen, Probleme direkter gelöst und ein kontinuierlicher Dialog mit der Nachbarschaft gepflegt werden.
Die Rolle des Projektbüros ändert sich im Laufe der Zeit: In der Planungsphase wird hier an Plänen, Visionen und Modellen gearbeitet. In der Entwicklung und während der Bauphase werden verschiedene Möglichkeiten der Nutzung erprobt, Vermietungsgespräche geführt und riesige Bauzeitenpläne gewälzt. Im Betrieb ist die Hausverwaltung vor Ort ansprechbar bei Fragen zur Nebenkostenabrechnung oder um Reparaturarbeiten zu koordinieren.
Neben der Kaffeemaschine sind noch weitere Einrichtungsgegenstände für ein einladendes und funktionierendes Projektbüro wichtig. Diese Liste bietet eine gute Übersicht. Für die Beschaffung kann teilweise auf gebrauchte Gegenstände oder Spenden zurückgegriffen werden, um Ressourcen zu schonen und das Budget zu entlasten.
Download
Checkliste Büroeinrichtung
Ladet eine praktische Checkliste für Büroeinrichtung herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.
Dem Finanzamt berichten
Der Jahresabschluss ist wie der jährliche „Kassensturz“ und muss spätestens sechs Monate nach Geschäftsjahresende beim Finanzamt eingereicht werden. Dazu gehören die Bilanz mit Aufstellung zu Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Jahresüberschuss, Rückstellungen und Verbindlichkeiten und die Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält zum Beispiel Aussagen über Umsatzerlöse, betriebliche Erträge, gezahlte Löhne, Abschreibungen, geleistete Zuwendungen und Verwaltungskosten (Paragraf 275 Handelsgesetzbuch, HGB). Bei komplexen Jahresabschlüssen, insbesondere von Kapitalgesellschaften, ist aufgrund der Vielzahl der gesetzlichen Regelungen die Unterstützung von Fachleuten (zum Beispiel Steuerberater*innen) dringend zu empfehlen.
Jährlich ist bei gemeinnützigen Gesellschaften ein Tätigkeitsbericht erforderlich – dieser zeigt, wie die gemeinnützigen Zwecke durch die Geschäftsführung erfüllt wurden. Außerdem sorgt der Tätigkeitsbericht dafür, dass das Finanzamt das gemeinnützige Wirken der Gesellschaft überprüfen kann. Ganz wichtig: Die in der Satzung genannten gemeinnützigen Zwecke müssen nachweislich erfüllt sein.
Download
Muster Tätigkeitsbericht
Ladet einen Muster Tätigkeitsbericht herunter und nutzt ihn für euer gemeinwohlorientiertes Projekt.
Gemeinnützigkeit und Mieteinnahmen
Gemeinnützige Organisationen dürfen Flächen vermieten und betreiben – dabei sind sehr enge Grenzen zu beachten. Wir raten euch daher dringend, ein*e Steuerberater*in zurate zu ziehen. Sind Flächen langfristig (das heißt mehrere Monate) an dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen vermietet, zählt das zur Sphäre Vermögensverwaltung und ist eher unbedenklich. Kurzzeitige Vermietung (zum Beispiel für eine Veranstaltung) gegen Entgelt ist aus steuerrechtlicher Sicht nur im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs möglich. Aber auch ohne Mietzahlung können (Gemeinwohl-)Flächen in bestimmten Fällen per Nutzungsvertrag zur Nutzung überlassen werden.
Neben dem ideellen Bereich und der Vermögensverwaltung kann ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eingerichtet werden. Dies erfordert eine doppelte Buchhaltung und die Umsätze des Geschäftsbetriebs dürfen nicht die Umsätze im gemeinnützigen Bereich überschreiten. Wir haben uns daher dafür entschieden, dass die Projektgesellschaften keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einrichten. In einigen unserer Projekte koordinieren gemeinnützige Träger – ein Verein oder eine Nachbarschaftsstiftung – die Aktivitäten auf den Gemeinwohlflächen. Für sie hat sich die Einrichtung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes als Beitrag zu einem selbsttragenden Betriebskonzept bewährt.
Finanzielle Rücklagen in der Gemeinnützigkeit
Gemeinnützige GmbHs dürfen Rücklagen nur eingeschränkt bilden, da die Mittel zeitnah für die gemeinnützigen Zwecke verwendet werden müssen. Ausnahmen gibt es für bestimmte Investitionen oder Risiken, aber genaue Vorgaben sind zu beachten. Diese sind in der Abgabenordnung (AO) und in dem entsprechenden Anwendungserlass (AEAO) geregelt. Hierbei hilft eine Beratung durch eine*n Steuerberater*in.
Projektgesellschaft und Bautätigkeiten versichern
Versicherungen schützen die Organisation vor finanziellen Risiken, die durch unvorhergesehene Ereignisse wie Unfälle, Schäden oder Rechtsstreitigkeiten entstehen können. Eine verlässliche Versicherungsstrategie stellt sicher, dass die gGmbH und das Immobilienprojekt langfristig stabil und handlungsfähig bleiben. Sie ist grundlegender Teil der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, den Mitarbeiter*innen und Partner*innen.
- Betriebshaftpflichtversicherung: schützt vor Schadensersatzansprüchen Dritter bei Personen- und Sachschäden, die durch das Unternehmen oder seine Mitarbeiter*innen im täglichen Geschäftsbetrieb verursacht werden.
- Rechtsschutzversicherung: übernimmt die Kosten für juristische Auseinandersetzungen, einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten, in Fällen von arbeitsrechtlichen oder geschäftlichen Streitigkeiten. Leider kommt es gerade im Planen und Bauen häufiger zu Auseinandersetzungen, die anwaltlich geklärt werden. Damit die Kosten im Rahmen bleiben, ist die Rechtsschutzversicherung unerlässlich. Für uns hat sich zusätzlich Mediation als vorgeschaltete Möglichkeit zur Konfliktbeilegung bewährt.
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht: schützt vor Ansprüchen Dritter bei Personen- oder Sachschäden auf dem Grundstück.
- Gebäudeversicherung: deckt Schäden am Gebäude durch Risiken wie Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser und andere Naturgewalten ab.
- Inhaltsversicherung: deckt Schäden an der Büroeinrichtung, technischen Geräten und anderen Gegenständen im Projektbüro ab, beispielsweise durch Feuer, Wasser oder Einbruch. Bei der Einrichtung von Projektbüros ist es ratsam, sie neu abzuschließen oder zu erweitern.
- Elektronikversicherung: versichert technische Geräte wie Computer, Server und andere elektronische Ausrüstung gegen Schäden durch Bedienungsfehler, Kurzschluss oder äußere Einflüsse. Bei hohen Ausstattungskosten ist sie empfehlenswert.
- Bauherrenhaftpflichtversicherung: schützt vor Schadensersatzansprüchen Dritter, die durch Bauarbeiten entstehen könnten.
- Bauleistungsversicherung: deckt unvorhergesehene Schäden am Bauprojekt ab, etwa durch Wetter oder Vandalismus.
Aus Kostengründen ist immer abzuwägen, welche der Versicherungen sinnvoll sind. Zu anderen Zeitpunkten der Projektentwicklung kann es sinnvoll sein, weitere Versicherungen abzuschließen.
Verträge mit Projektpartner*innen abschließen
Es hat sich bewährt, Pflichten und Zusagen von Projektpartner*innen möglichst früh im Prozess in verbindlichen Vereinbarungen festzuhalten. Früh heißt hier: bevor große Geldsummen zum Beispiel für Architekturleistungen oder Umbauten investiert sind oder Zusagen gegenüber späteren Mieter*innen oder Nutzer*innen gemacht werden. Die Praxis hat gezeigt, dass eine schriftliche Vereinbarung eine Sicherheit für alle Beteiligten bringt und Pflichten, Aufgaben und Prozesse klärt.
Unseren Projekten liegt immer ein Zusammenwirken der gemeinnützigen Projektgesellschaft mit der Stadt beziehungsweise der Kommune zugrunde, die damit einen bedeutenden eigenen Beitrag zur gemeinwohlorientierten Stadtteilentwicklung leistet. In den Vereinbarungen wird beschrieben,
- wie die Zusammenarbeit gestaltet wird, um das angestrebte gemeinwohlorientierte Quartiersprojekt umzusetzen.
- Die jeweiligen Beiträge, Pflichten und Verantwortlichkeiten der Partner*innen werden detailliert festgelegt,
- die Ziele des Projekts erläutert und
- die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit definiert.
- Die Vereinbarung legt außerdem fest, wie ein Konflikt beigelegt und
- unter welchen Bedingungen die Zusammenarbeit beendet werden kann.
Download
Muster Kooperationsvereinbarung
- Ladet eine Muster Kooperationsvereinbarung herunter und nutzt sie für euer gemeinwohlorientiertes Projekt, um die Inhalte der Kooperation und die Beiträge der Kooperationspartner*innen vertraglich festzuhalten.
- Zur Kooperation zwischen gemeinnütziger Vermieterin und gemeinnütziger Betreiberin einer Gemeinwohlfläche gibt es eine gesonderte Muster Vereinbarung, da im Betrieb bestimmte Abläufe zu regeln sind.